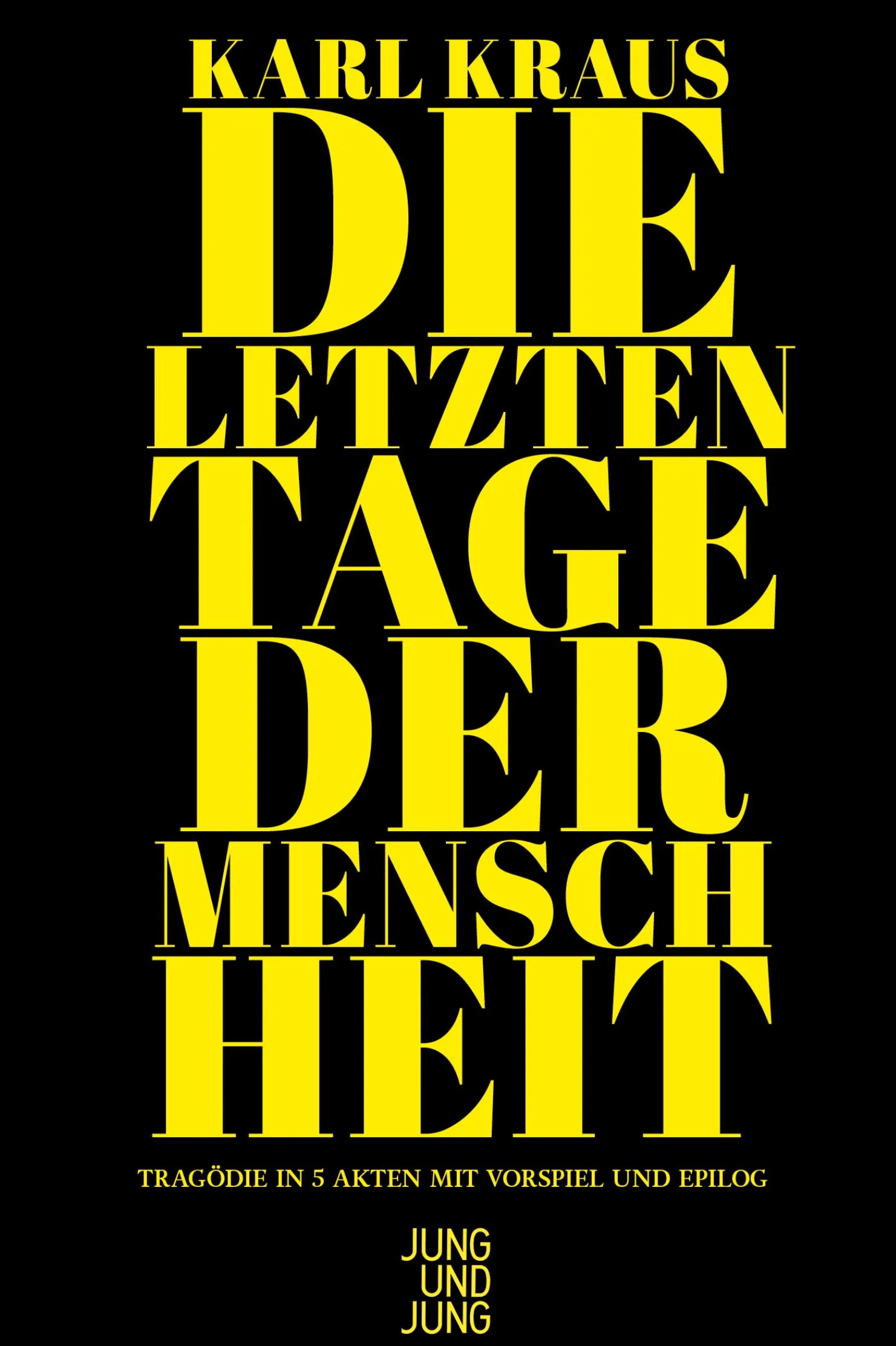Amir Tibon erzählt in „Die Tore von Gaza“ vom 7. Oktober. Wie funktioniert so ein Text auf der Bühne?
Vorab eine Buchempfehlung: Auf gut 400 Seiten schildert Amir Tibon in Die Tore von Gaza den Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 aus eigenem Erleben. Der 1989 geborene Journalist wohnte mit seiner Frau und zwei kleinen Töchtern damals im Kibbuz Nahal Oz unweit der Grenze zum Gazastreifen. Um 6.29 Uhr erwachten die Eltern zu ersten Geräuschen der Invasion und zogen sich zu ihren noch schlafenden Kindern in den Schutzraum ihres Hauses zurück. Die packende Schilderung dieses schrecklichen Tages und seiner Folgen ergänzt Tibon um einen historischen Abriss des Konflikts in der Region, dessen Wurzeln in die Zeit vor der Gründung des Staates Israel zurückgehen. Seine Perspektive ist unweigerlich die eines Israelis und linken Zionisten, zudem eines Zeitzeugen, der mehr oder weniger zufällig den Terror überlebte. Doch der Text ist frei von Hass und Vorurteilen. Gezielt hat er ihn nicht auf seiner Muttersprache Hebräisch, sondern auf Englisch verfasst – für die Welt, wie er bei einer Veranstaltung des Salzburger Landestheaters erklärte.
Anlass für das Gespräch war die Uraufführung der Bühnenversion von Die Tore von Gaza durch den neuen Schauspieldirektor des Landestheaters, Nuran David Calis. Ihm war es so wichtig, als erste Regiearbeit im Amt diesen schon im Herbst 2024 erschienenen Text zu inszenieren, dass er dafür eine besondere Spielstätte in Anspruch nahm: die Bühne 24, auch bekannt als das traditionsreiche Salzburger Marionettentheater.
Die Frage nach der Eignung eines erzählenden Sachbuchs für die Bühne blieb für Calis dabei augenscheinlich im Hintergrund. Seine Inszenierung zeigt auffällig großen Respekt vor dem Ausgangsmaterial, was Text, Form und Aufbau betrifft. Innerhalb des Ensembles wurden zwar Figuren zugeschrieben – Aaron Röll verkörpert etwa Amir Tibon, Larissa Enzi seine Frau Miri –, aber die Narration zitiert unverändert aus dem Buch und bleibt somit in der Ich-Perspektive des Autors. Gleiches gilt für Britta Bayer und Georg Clementi in den Rollen von Tibons Eltern, die nach kurzem Austausch von Textnachrichten von Tel Aviv aus in die Gefahrenzone aufbrachen: „Mein Vater“, sagt Clementi dann eben über sich.
Weiterlesen im Freitag 41/25