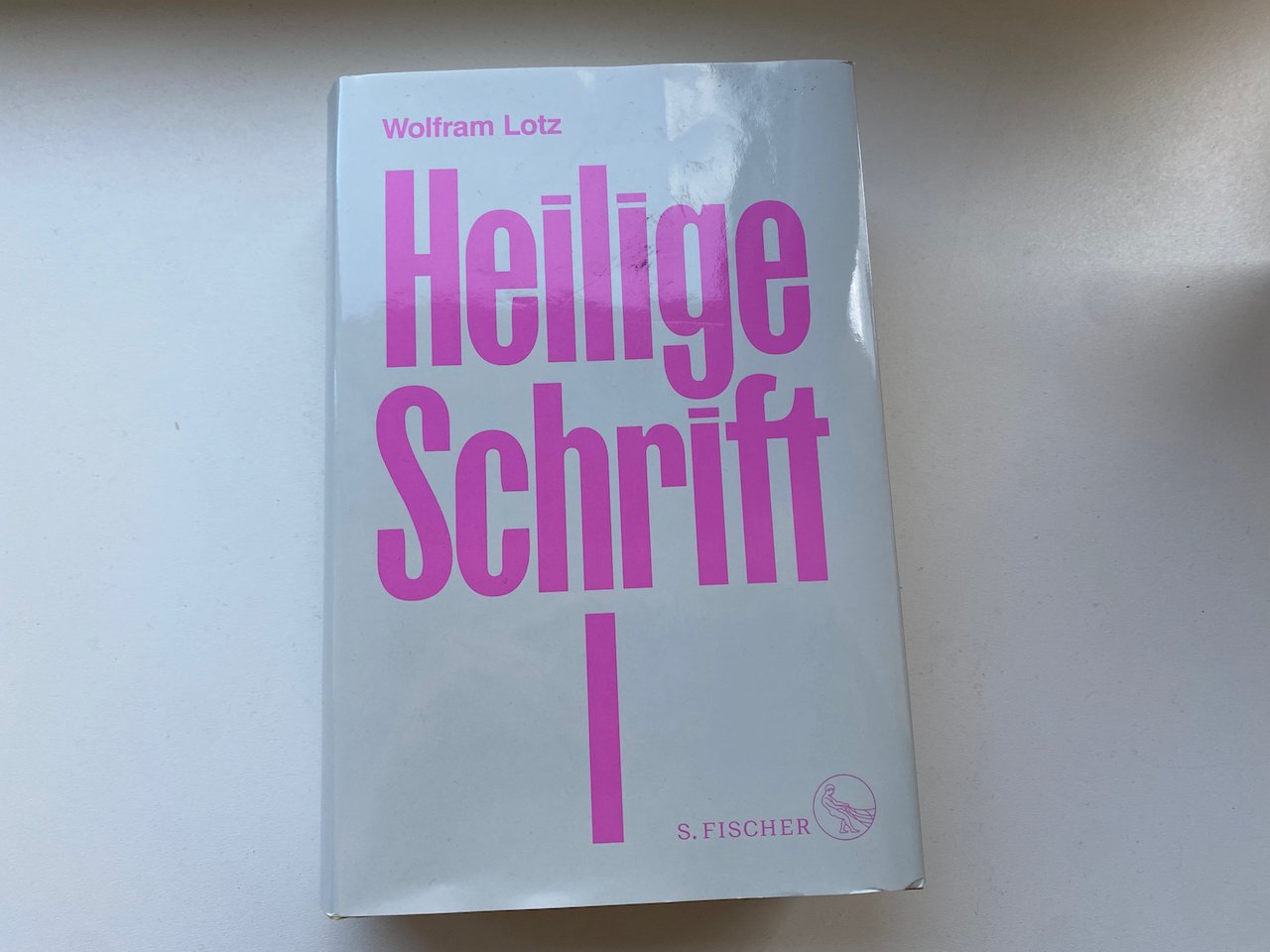Wolfram Lotz hat ein Jahr Tagebuch geschrieben und es dann gelöscht. Der gerettete und nun veröffentlichte Anfang ist Ausdruck größter schriftstellerischer Freiheit.
Das Monströse – irgendwie wohnt es allen Texten von Wolfram Lotz inne. Aber in diesem Fall wurde es ihm zu viel. Die Theaterstücke des 1981 in Hamburg geborenen Autors, etwa „Einige Nachrichten an das All“ und „Die lächerliche Finsternis“, sind stets so geschrieben, dass alle sie aufführen wollen, aber niemand es kann. Zumindest nötigen sie Regisseur/innen zu radikalen Eingriffen, hinter denen die Sprache dennoch kenntlich bleibt, so besonders ist sie.
Hier aber schrieb Wolfram Lotz einen Text nur für sich, als Selbstversuch. Seine Partnerin trat für ein Jahr eine Stelle als Lehrerin an einer Schule in Frankreich, nahe der deutschen Grenze, an. Das Paar bezog mit den beiden kleinen Söhnen ein Häuschen in einem öden Dorf, weit und breit nichts. „Ich hatte eine immense Panik vor dem Dorf als soziales System, als Weltabgewandtheitshöhle“, erklärt Lotz. „Dadurch entstand dieses Schreiben, auch als Notwehrimpuls. Ich dachte, wenn ich in dieses Dorf gehe, dann sterbe ich da. Nicht buchstäblich, aber innerlich, die Augen sterben, das Leben verschwindet aus mir – und ich dachte, ich will schreibend anhand der Dinge lebendig sein.“
Im Tagebuchformat wollte er von morgens bis abends Dinge aufschreiben: was ihm so einfiel, was er sah, wenig über das Familienleben und doch allumfassend, ohne Überarbeitung und ohne Publikation, wobei Letzteres vielleicht doch: „So wie schreiben ja immer sein soll, für mich jedenfalls / SELBSTGESPRÄCH BEI OFFENEM FENSTER / dieses merkwürdige Sowohlalsauch“, heißt es auf der ersten Seite am 8. August 2017.
Notizbücher und Computerdateien füllten sich, das Projekt wuchs zum größten in Lotz’ Leben an. „Ich wusste durch dieses Historisieren ab und zu nicht mehr, ob das, was am Vormittag gewesen war, nicht vielleicht schon zwei Tage zurücklag“, erinnert er sich. Nicht nur Freunde erfuhren von der Existenz des Tagebuchs, auch die Lektorin im Theaterverlag, der die Stücke des Dramatikers vertritt, und in weiterer Folge die deutschsprachige Theaterszene, die bekanntlich ihrerseits ein Dorf ist. Der Wunsch nach Veröffentlichung wurde laut, bei Lesungen präsentierte Lotz sogar Ausschnitte aus dem Text, der allmählich Legende wurde und eine mystische Aura annahm. Dass die nun erschienene Publikation den Titel „Heilige Schrift I“ trägt, ist in jeder Hinsicht passend.
Dann waren zwölf Monate vorbei, 2700 Seiten entstanden. Lotz gab sich ein paar Wochen Bedenkzeit, sicherte ausgewählte Stellen in einer anderen Datei und klickte dann auf „Löschen“.
Weiter in der Buchkultur 202