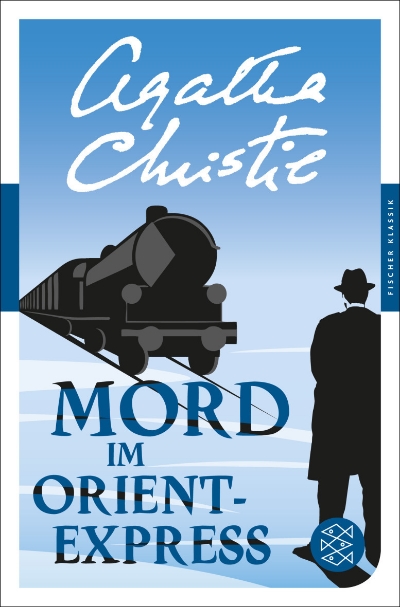Agatha Christie
Mord im Orient-Express
Deutsch von Otto Bayer
S. Fischer, 8,30 Euro
Der WIENER liest für Sie Klassiker der Weltliteratur. Diesmal: das zugkräftigste Whodunit aller Zeiten zum 125. Geburtstag der Queen of Crime
“Es ist widersinnig – unwahrscheinlich – es kann gar nicht sein. Das habe ich mir auch gesagt. Und dennoch ist es so, mein Freund. Vor Tatsachen gibt es kein Entrinnen.”
Kein Entrinnen. Eine solche Tatsache lautet, dass sie alt geworden ist und auch ein bisschen Staub angehäuft hat, die Königin des Krimis. Am 15. September wäre Agatha Christie 125 Jahre alt geworden, und in ihrem Genre gibt es heute Urwälder von Buchseiten, die fesselnder, ärger, tiefgründiger, regionaler oder skurriler sind als ihre 66 Detektivromane. In einer Hinsicht bleibt Dame Agatha jedoch auf weiter Flur unübertroffen: Niemand treibt das Konzept des Whodunits besser auf die Spitze, vereint so gekonnt alle Kräfte zur Erreichung eines einzigen Ziels: möglichst lange im Dunkeln zu halten, wer der Täter ist, und dann am Ende eine sehr überraschende Katze aus dem Sack zu lassen.
Das wohl berühmteste Produkt dieser Virtuosität ist „Mord im Orient-Express“: 1934 erstmals erschienen, mit einem der Realität entnommenen Entführungsfall als Hintergrundstory, vielfach durchaus schlecht verfilmt, einmal dafür durch Sidney Lumet 1974 saugut, was einen Oscar für Ingrid Bergman als verbrämtes schwedisches Kindermädchen und Nominierungen für Albert Finney in der Hauptrolle, für Kamera, Musik, Drehbuch und Kostüm nach sich zog.
Der „Mord im Orient-Express“ wird mit mehreren Messerstichen an dem ehemaligen Kidnapper Cassetti begangen. Die Besonderheiten dabei: Niemand ist wirklich traurig, dass das Opfer tot ist, und der Kurswagen von Istanbul nach Calais ist erstens rammelvoll, bleibt zweitens mitten in der jugoslawischen Pampa im Schnee stecken und erfreut sich drittens zufällig der Anwesenheit des belgischen Meisterdetektivs Hercule Poirot.
Höchst reißbrettartige, aber umso perfektere Vorgaben für ein technisch sauberes Whodunit mit unzähligen Figuren aus unterschiedlichen Ländern (was nebenbei die eine oder andere bizarre Klischeevorstellung einer Britin in den Dreißigerjahren zutage bringt) und einer glasklaren Struktur: Einleitung – Mord – Verhöre durch Hercule Poirot, der eigentlich von Anfang an Bescheid weiß, es aber gerne spannend macht – Poirot zieht sich zurück und denkt nach – und gibt dann vor etwa 15 gebannten Zuhörern im Speisewagen eine ausführliche Auflösung bekannt, die natürlich hier absolut nicht verraten wird. Es kann so einfach sein, es sich genial zu machen.
ACHTUNG, SPOILER!
Wer war’s? Wir fassen die erstaunlichsten Auflösungen der Christie-Krimis zusammen
„Alibi“ (1926)
Der Roman (im Original: „The Murder of Roger Ackroyd“) hat Agatha Christie berühmt gemacht. Es war ihr sechster und der vierte mit Hercule Poirot, der sich hier einen Wohnsitz auf dem Land zulegt. Der Landarzt Dr. James Sheppard, der den Detektiv bei seinen Ermittlungen begleitet, fungiert als Ich-Erzähler der Geschichte. Am Ende hat das Ich dann zu erzählen, dass es höchstselbst von Poirot des Mordes überführt wird. Ich-Erzähler = Täter, das hat es seitdem ein paar Mal gegeben, davor aber noch nie.
„Das Haus an der Düne“ (1932)
Spätestens nach der Lektüre von „Das Haus an der Düne“ muss jeder Krimileser stutzig werden, wenn es „die Falsche erwischt“, wenn also, etwa nach mehreren vereitelten Anschlägen auf Person A, eine andere umgebracht wird (Person B), wobei es so aussieht, als hätte es eigentlich die gefährdete Person A treffen sollen. War natürlich alles geschickt inszeniert – A wollte B loswerden und den Verdacht von sich ablenken.
„Und dann gabs keines mehr“ (1939)
Einst als „Zehn kleine Negerlein“ bekannt (aus naheliegenden Gründen ist der Titel heute nicht mehr vertretbar), kreiert dieser Thriller eine scheinbar unmögliche Situation: Zehn Menschen kommen auf einer einsamen Insel zusammen und werden nacheinander ermordet. Der Leser denkt: Irgendwann muss das Morden ja enden, und doch sind am Ende alle tot. Erst nachträglich enthüllt ein Abschiedsbrief von Opfer Nr. 6 die Wahrheit: Der Mann hatte sich nur totgestellt.
„Vorhang“ (1975)
Hercule Poirots letzter Fall mündet in zwei kaum erträglichen Erkenntnissen: Hercule Poirot ist tatsächlich gestorben (einen so menschlichen Akt hatte man dem stets eher vergeistigten, abgehobenen Mann gar nicht zugetraut), und: Er hat einen Mord begangen. Da er keine Beweise gegen den kaltblütigen Serienmörder Norton hatte, übte er Selbstjustiz. Interessant ist auch die Geschichte dieses Buches: Christie hortete das Manuskript jahrzehntelang und gab es erst kurz vor ihrem eigenen Tod zur Veröffentlichung frei, um nichts Neues mehr schreiben zu müssen.
MÖRDERISCHES
NICHT ZU GLAUBEN: Der Blitz-Bildungs-Express führt Sie in Zitaten durch den Roman
“Es ist nicht zu glauben, Monsieur. Alle Welt will heute Nacht verreisen.”
“Haben Monsieur es noch nicht gemerkt? Der Zug ist stehen geblieben. Wir stecken in einer Schneeverwehung fest. Weiß der Himmel, wie lange uns das hier aufhält. Ich erinnere mich, dass wir einmal sieben Tage eingeschneit waren.”
“,Ah, quel animal!‘ In Monsieur Boucs Ton lag abgrundtiefe Verachtung. ,Ich vermag seinen Tod nicht im mindesten zu bedauern, wahrhaftig nicht.‘ ,Da bin ich ganz ihrer Meinung.‘ ,Tout de même, es musste nicht ausgerechnet im Orientexpress sein. Man hätte ihn anderswo umbringen können.‘”
“Lügen über Lügen. Ich kann es nicht fassen, wie viele Lügen uns heute Vormittag aufgetischt wurden.”
“„,Gut so‘, sagte Monsieur Poirot. ,Nachdem ich Ihnen also meine Lösung unterbreitet habe, werde ich nunmehr die Ehre haben, mich von dem Fall zurückzuziehen ...‘”