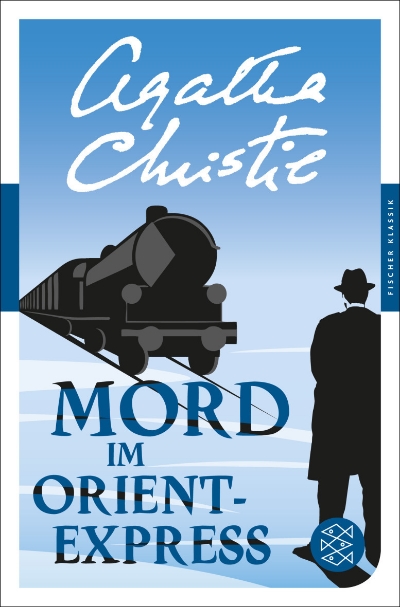Hierzulande blickt man auf englisches Theater mit einer Mischung aus Herablassung ob der als konservativ geltenden Herangehensweise und Bewunderung für die Präzision und Genauigkeit, mit der Inszenierungen (meist en suite) sich selbstbewusst ihrem Publikum präsentieren. Ein kurzfristig (beruflich, bitte sehr) eingeschobenes verlängertes Wochenende gab mir Gelegenheit, einen Blick auf zwar zeitgenössisches englisches Theater zu werfen, das aber unverbrüchlich dem Motto „Trust the play!“ folgt. Es sind die Tage, da ein hysterischer Mob einen Blick auf Benedict Cumberbatch als Hamlet zu erhaschen versucht, aber darauf lasse ich mich gar nicht erst ein (obwohl es nicht unmöglich ist, Karten zu kriegen, wie ich erfahren habe). Ich nehme mir zwei Autoren vor, die wir auch im deutschsprachigen Raum durchaus kennen und deren neue Stücke nach gewissen Logiken unter Umständen bald auch bei uns zu sehen sein könnten: Patrick Marber und Martin McDonagh.
Dabei stelle ich wieder einmal fest, was ich am englischen Theater so faszinierend finde: Es arbeitet souverän im Sinne des Zuschauers, ist sich bewusst, dass es von ihm abhängig ist, und macht sich daher keine Komplexe darum, ob es ihm nun umständlich auf künstlerischem Wege Gefälligkeiten erweist. „Das Stück dauert zwei Stunden und fünfundzwanzig Minuten“, erklärt die freundliche Kartenabreißerin jedem einzelnen Zuschauer. „Es gibt keinen Nacheinlass, und auf der Bühne wird geraucht, außerdem gibt es künstlichen Nebel.“
„Danke“, sage ich strahlend, fühle mich informiert (auch wenn ich das so genau jetzt gar nicht hätte wissen müssen, aber ebendarum erst recht) und harre gut gelaunt und offenherzig dessen, was kommt. Im Zuschauerraum sitzt ‒ sowohl im Dorfman Theatre, der kleinsten Spielstätte des National, als auch im Royal Court Theatre ‒ ein erfreulich gemischtes Publikum aller Hautfarben und Altersschichten. In Wien, sofern mich mein Eindruck nicht völlig täuscht, gibt es das selten so divers. Und dann sehe ich zwei neue Stücke, die man versucht sein könnte, Well-Made Play zu nennen, weil sie gut gebaut sind, aber so ganz trifft es das in beiden Fällen nicht. Um es vorwegzunehmen: Beide hauen mich nicht um, faszinieren mich aber auf eine gewisse Weise.
„The Red Lion“ von Patrick Marber ‒ sein erstes Stück im neuen Jahrzehnt, aber er scheint wieder voll im Geschäft zu sein, Plakate für eine Turgenew-Bearbeitung hängen schon ‒ handelt von Fußball. Ich interessiere mich wirklich nicht für Fußball. Auch für dieses Drei-Mann-Stück interessiere ich mich eigentlich nicht, der heftige Dialekt besonders des zwielichtigen Trainers bereitet mir zugegebenermaßen Schwierigkeiten. Aber ich kann mich trotzdem auf das Drama einlassen, das die Vertragsverhandlungen mit einem vielversprechenden Jungstar in einem semiprofessionellen Provinzverein auslösen. Die Selbstverständlichkeit, mit der durch Spiel, Aufwand der Kulisse (eine minutiös versiffte Umkleidekabine) und Temperatur behauptet wird, dass es hier um etwas wirklich Existenzielles geht, betört. Und die „blokes“ rund um mich, mit ihrem Bier, das sie in den Zuschauerraum mitnehmen durften (ein bisschen was ist von den wilden Shakespeare-Zeiten ja noch übriggeblieben), sehen das klarerweise genauso. Ian Rickson hat inszeniert, Daniel Mays, Peter Wight und Calvin Demba, der aussieht, als wäre er wirklich nicht der Schauspielschule, sondern einem Sportclub enthoben worden, bringen die teils pathosgetränkten Zeilen von Anfang bis Ende überzeugend.
Im Royal Court hat Martin McDonagh gerade erst kürzlich sein neuestes Stück herausgebracht. Es heißt „Hangmen“ und erfordert ein für ihn ungewöhnlich großes Personal von über zehn Figuren. Ebenso wie am Vorabend ist es die Bühne, die mich schmunzelnden Erstaunens den Kopf schütteln lässt. Dieser Aufwand! Alle deutsch(sprachig)en Dramaturgen und die meisten Kritiker würden den Kopf noch heftiger schütteln, sie würden es gar nicht aushalten, dass jemand (in diesem Fall konkret Regisseur Matthew Dunster und Ausstatterin Anna Fleischle) für ein Stück mit drei Schauplätzen, zwei davon in nur je einer einzigen Szene, drei bis ins kleinste Detail ausgeschmückte Bühnenbilder baut. Umbauumstände gibt es trotzdem keine: Die Todeszelle aus Szene eins wird gen Decke gezogen, um das Sechzigerjahre-Pub zu offenbaren, und das kleine Café, in dem sich einmal zwei verbrecherische Gestalten treffen, hockt hinter der oberen Wandverkleidung des Pubs.
Und in diesem Fotorealismus spielen dann Möchtegern-Gentlemen, Ganoven und Säufer eine schwarze Komödie im Stil der letzten McDonagh-Jahre ab, mit dem Unterschied, dass ein englischer, kein amerikanisch angehauchter Geist regiert. Der zweitbeste Henker Englands gibt am Tag der Abschaffung des Hängens (1965, gehe mal davon aus, dass das historisch akkurat ist) ein Interview. Unterdessen macht sich an seine Tochter ein unangepasster Fremder (grandios psychopathisch: Johnny Flynn) ran. Mein Bezug zu McDonagh ist ja ein spezieller, sodass ich Humor und Schwärze anhand der „Enthandung in Spokane“ zu bewerten geneigt bin. Der Humor (inkl. i-Tüpfel-Reiterei und Wortverherrlichung) ist da, die Schwärze auch, aber in die Ambivalenzkuhle zwischen Hochkultur und Boulevard trifft „Hangmen“ nicht so perfekt hinein wie die „Enthandung“, landet eher relativ sicher jenseits davon, also auf dem Boulevard. Vielleicht erweckt diesen Eindruck aber auch nur die Inszenierung, die dem dreckigen McDonagh etwas zu viel Gediegenheit entgegensetzt (und ja, da spricht jetzt endgültig der aus dem deutschen Theater Kommende aus mir).
Werden wir diese Stücke, den neuen Marber, den neuen McDonagh, bald irgendwo auf Deutsch sehen? Sicher ist es nicht, sie sind ja beide nicht Simon Stephens. „The Red Lion“ eher nicht, thematisch zu speziell. Und „Hangmen“: Puh, nein. Außer das Wiener Theater in der Josefstadt traut sich vielleicht mal an den unflätigen Einzelgänger heran.