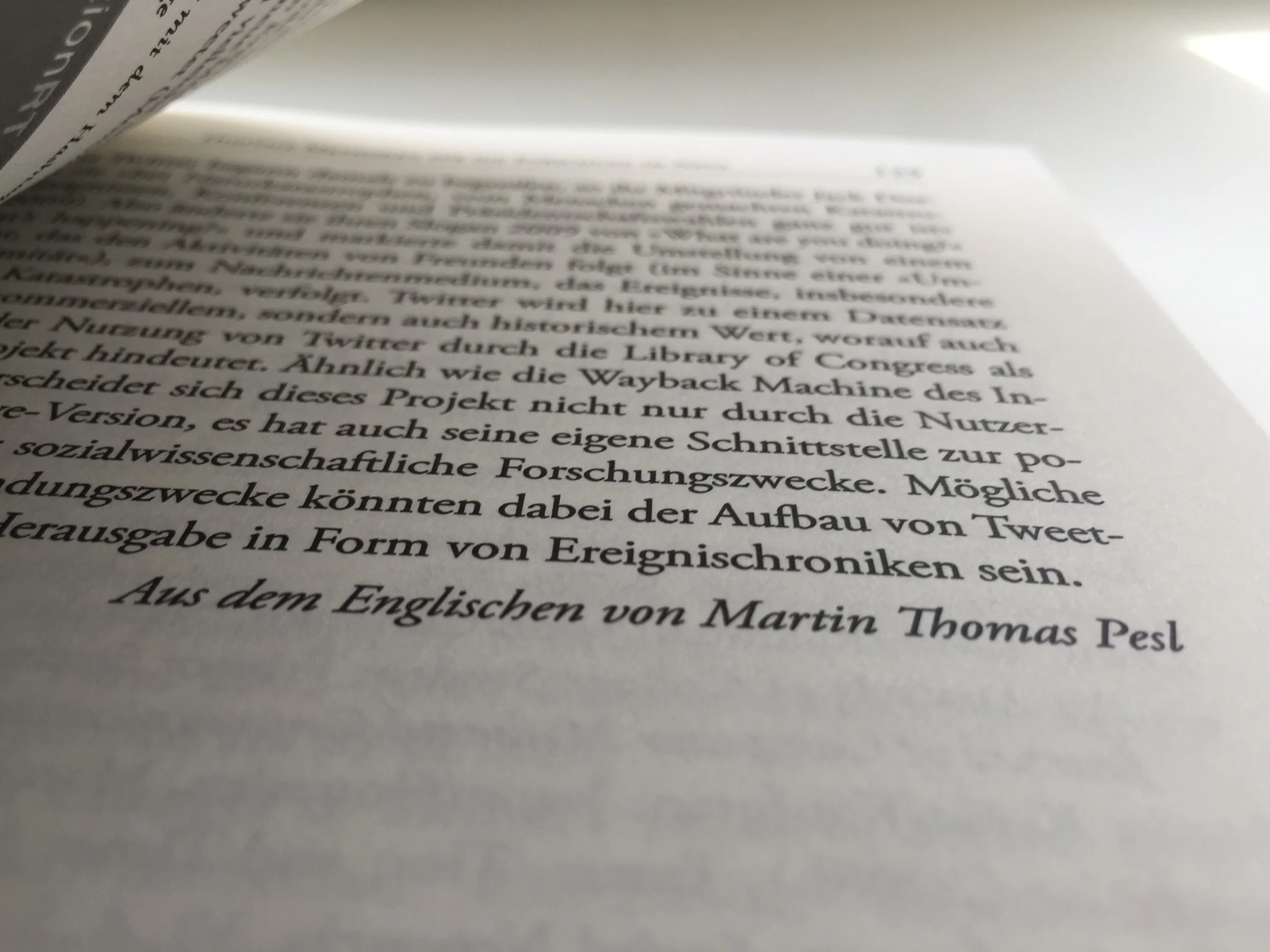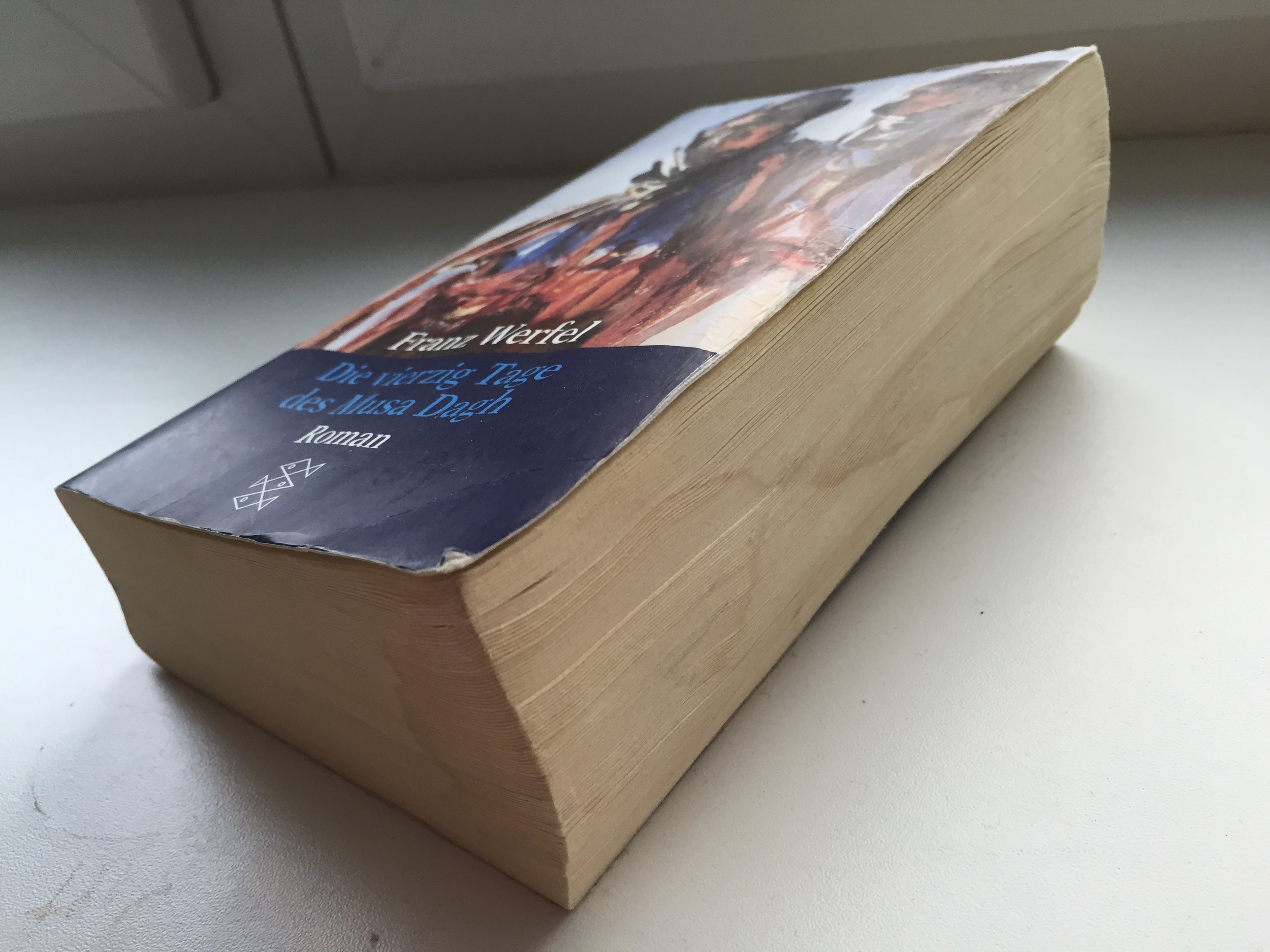ARKALAMEKK UND CO.
DIE SCHÖNSTEN WORTKREATIONEN VON D’ARRIGO/KAHN
Erohräugen
Seinem Autor zu Ehren schöpft Übersetzer Moshe Kahn Wörter, dass einem Hören und Sehen vergeht. Die, bei denen es ums Hören und Sehen geht, sind dabei besonders hübsch. So stellt er immer wieder das Hörengesagte dem Mitdenaugengesehenen gegenüber, und aus „oreocchiare“ werden das „Erohräugen“ und in weiterer Folge die „Ohraugen“.
Pomponade
Was wie buntes Gel in den Haaren klingt, macht sich auch als Ausdruck für Firlefanz und Affentheater ganz gut. D’Arrigos ursprüngliche Wortschöpfung lautet „pomponella“. Das französische Wort für Quaste, „pompon“ steckt auch drinnen.
Fere
Heftige Diskussionen entbrennen zwischen den Matrosen, ob die flinken Fischwesen, die sie umströmen, nun einfach schnöde Delfine oder zauberhafte Feren sind. Auf Sizilianisch sind Delfine „feruni“, aber auch der lateinische Wortstamm für „wild, ungezähmt“ ist hier zu finden. Also: Eine Fere ist ein Delfin, aber eigentlich auch nicht. Denn der Delfin bleibt in den Köpfen lieb und lustig, und der Fere komm besser nicht in die Quere.
Chinesischesdingsda
Hierbei handelt es sich um das männliche Genital. „Dingsda“ ist klar (und passt auch zum weiblichen Gegenstück, dem „Dingding“ oder „Glöckchen“, mit dem die kecke Ceccina Circé sogar die wilden Feren zähmt), warum es chinesisch ist, kommt einem ohne Italienischkenntnisse jedoch etwas spanisch vor.
Arkalamekk
Was für ein wundervolles Wort! Es bedeutet etwas Seltsames, Faszinierendes, Köstliches, Doppelbödiges, Dunkles. In dem Wort verbindet sich Mekka, Glücks- und Sehnsuchtsort, mit der Arche, dem archetypischen (!) Boot aller Boote.