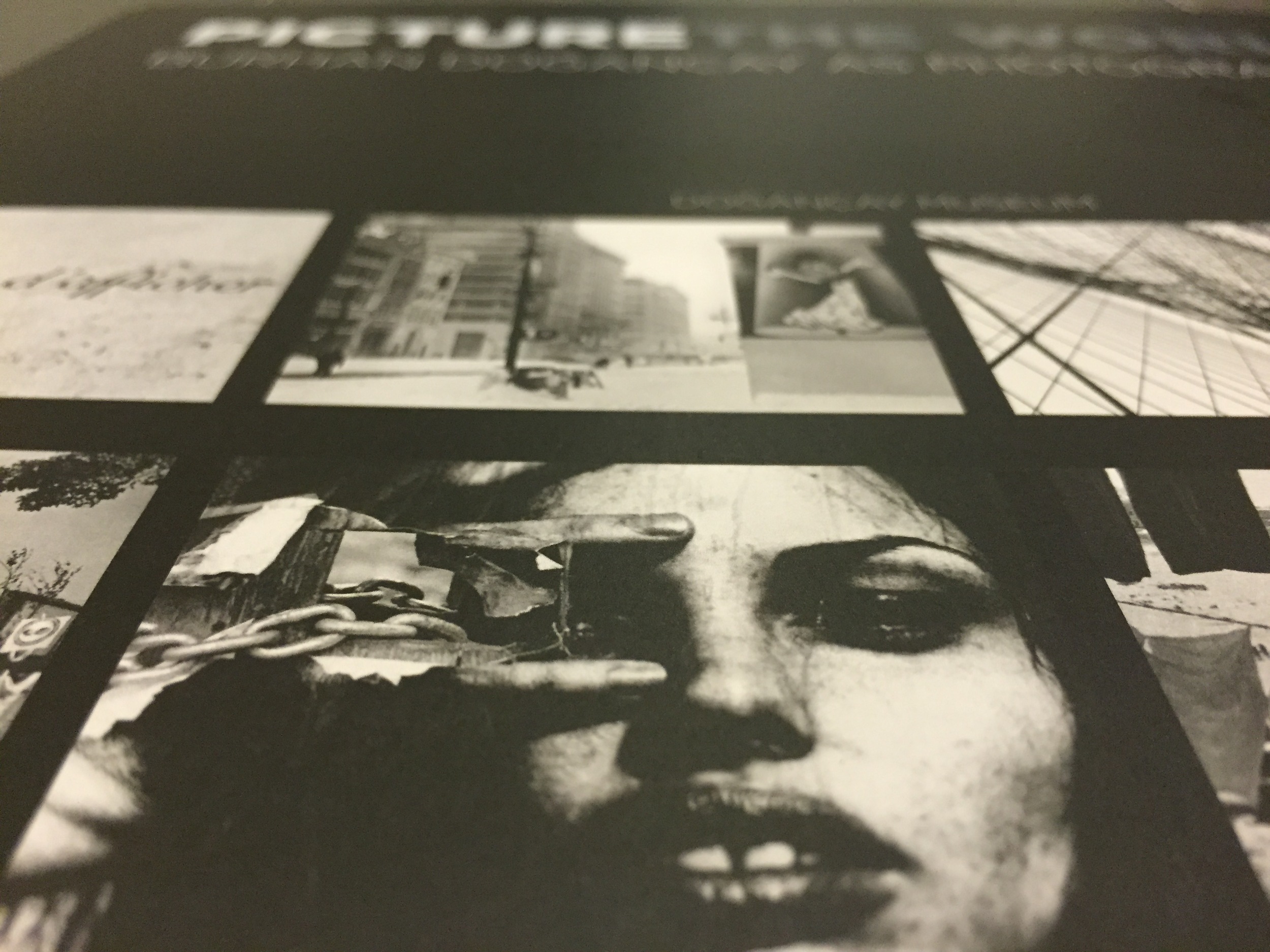Der Hundertjährige, der durchs Fenster stieg und nicht mehr gehen wollte
Über eine gesamtgesellschaftliche Sinnsuche des vergangenen Gedenkjahres zum 1. Weltkrieg in Romanform
Jetzt ist es auch schon wieder vorbei, das große Gedenkjahr 2014. Keine Institution kam daran vorbei, den großen Krieg zu thematisieren, wenn sie nur in irgendeiner Form ein Programm zu gestalten hatte: ein informatives, ein kulturelles, ein unterhaltendes. Es nicht zu tun, ging nicht, gleichzeitig musste man sich dessen bewusst sein, dass alle anderen es auch tun werden, und sich kreativ von ihnen abheben. So manche Kuratoren, Verlegerinnen, Dramaturgen und Intendantinnen werden den Ersten Weltkrieg verflucht haben, und das nicht nur, weil er halt schrecklich war.
Auch die Edition Atelier hat ein Buch zum Thema herausgebracht, klar. Aber Das lange Echo von Elena Messner ist ein ganz besonderer Beitrag, weil es das Metabuch zum Gedenkjahr ist. Es ist das prophetische Prequel, die vorgeschickte Erinnerung an die Erinnerung. Es behandelt den Krieg, vor allem aber die Behandlung des Krieges im überspannten wissenschaftlichen Diskurs anno 2014. Erschienen ist es im Frühjahr, geschrieben wurde es naturgemäß noch bevor das große Jahr eingeläutet wurde. Und wie war es jetzt wirklich?, haben wir Elena Messner gefragt. »Museen, politische Gruppen, Verlage, Theater und Medien haben ihren politischen Positionen entsprechend agiert, insofern gab es da keine großen Überraschungen«, resümiert sie, die mittlerweile in Marseille lebt. »Das Österreichische Kulturforum und die österreichische Botschaft in Belgrad haben Vorträge dazu organisiert, welche Schuld Habsburg am Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte, die Kriegstreiberei im Rahmen der Julikrise 1914 von damaligen Militärs und Politikern wurden thematisiert. Parallel dazu wurden aber auf ›inoffizieller‹ Ebene in Medien oder von einzelnen österreichischen Verlagen mit entsprechender Ausrichtung ganz entgegengesetzte Interpretationen der Ereignisse geliefert, die entlastende Funktion hatten. ›Sinn‹ ist ohnehin etwas, das politisch und kulturell mitkonstruiert wird, und insofern, wenn ich polemisch sein darf, dienen solche Gedenkjahre der gesamtgesellschaftlichen Sinnsuche.«
Die 1983 in Klagenfurt geborene Elena Messner hat in die Vorbereitungen zu dem einen oder anderen Gedenkprojekt hineingeschnuppert und dabei gerade in Österreich eher eine Verteidigungshaltung als ein reflektiertes Gedenken vorgefunden. Das inspirierte die Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Dozentin dazu, für ihren Roman einen Wiener Weltkriegsgedenkkongress zu erfinden, wie er bestimmt genau so irgendwann im Jahr 2014 stattgefunden hat, und an dem sich zwei Historikerinnen über die Interpretation eines Vorfalls aus dem Jahr 1916 streiten. Dabei gelingt es der Autorin, auf nicht einmal 200 Seiten sowohl besagten Vorfall aus dem Kriegsgeschehen als auch die darüber geführte – und über einem Bier beim Stadtheurigen fortgesetzte – Debatte auf den Punkt zu bringen und zu verdichten.
Eine als Roman getarnte trockene historische Abhandlung ist das schon deshalb nicht, weil sowohl die alte, als auch die neue Geschichte zwar gründlichem Quellenstudium entwachsen, aber rein fiktiv sind. Vielmehr zeigt Messners Streitgespräch, von wie vielen Schichten die Beschäftigung mit der Vergangenheit überlagert wird, und wenn es nur eine gar gegenwärtige persönliche Antipathie ist, kombiniert mit dem Wunsch, einen stillen Zuhörer zu beeindrucken. Dass sich die Verfasserin dabei ungeniert auf die Seite der jungen Assistentin wirft, die die rückwärtsgewandte Direktorin des Heeresgeschichtlichen Museums angreift, stört dabei nicht. Im Gegenteil, es erleichtert den Zugang zur anderen Geschichte: zu jener des slawischstämmigen Soldaten Milan Nemec, der auf der Seite der Habsburger kämpfen musste und dabei angesichts skrupelloser Gräuel, wie sie in militärhistorischen Kontexten beim Erinnern gerne vergessen werden, seines Patriotismus verlustig ging. Und ganz am Rande reüssiert der Roman noch auf einer anderen, durchaus überraschenden Nebenfront: »Jemand hat mir gesagt, ich hätte die schönste Liebesgeschichte geschrieben, die er je gelesen hat«, berichtet Elena Messner.
Da die Autorin in Marseille lebt und unterrichtet – übrigens in Vorbereitung eines neuen Romans über diese Stadt –, hat sie 2014 relativ wenig österreichischen Gedenkprunk besucht. Im Heeresgeschichtlichen Museum war sie aber natürlich, und obwohl sie betont, dass das gleichnamige Haus in ihrem Buch nicht mit dem realen Museum identisch sei – »auch wenn weder Figuren noch Räume und Denkweisen völlig frei erfunden sind« –, fühlte sie sich in ihren sarkastischen Prophezeiungen bestätigt. »In diesem Jahr wurden mehrere Millionen für einen Umbau im Museum ausgegeben. Die Fetischisierung der Militärobjekte wurde innenarchitektonisch weitergetrieben, indem man versucht, den Blick auf die Objekte zu lenken, die wie Reliquien ausgestellt sind. Dieses Konzept ist eine aussagekräftige Antwort auf die letzten Zeilen meines Romans.«
Der altbekannte Slogan des Hauses, »Kriege gehören ins Museum«, lasse zwar auf eine reflektierte Betrachtung österreichischer Militär- und Gewaltgeschichte hoffen, doch sei, so beobachtet die Autorin, das Heeresgeschichtliche Museum mit der neuen Ausstellung »einen armee- und habsburgaffinen Weg« gegangen. »Ausgeblendet werden weiterhin Kriegsverbrechen der Habsburgischen Truppen, die komplizierten Ursachen des Krieges, das Grauen in den Schlachten, das zivile Leben im Krieg, das tägliche Leiden der Soldaten oder die komplizierte Frage des Zusammenhangs von Politik und Gewalt«, kritisiert sie. »Dabei sind Militärmuseen nicht zwangsweise dazu verdammt, armeeaffine Ausstellungen zu produzieren, die unkritisch mit der Militärgeschichte ihres Landes umgehen. Das vergleichbare Museum der Bundeswehr in Dresden hat etwa einen ganz anderen Weg eingeschlagen.«
Und das Thema Krieg geht weiter. »Nächstes Jahr kann man mit vier Anlässen gleich weitermachen: 200 Jahre Wiener Kongress, 70 Jahre Kriegsende, 60 Jahre Staatsvertrag, 20 Jahre EU-Beitritt«, macht Messner nicht gerade Lust auf die nahe Zukunft. »Nicht jedes ›Jubiläum‹ wird von einer breiten Bevölkerungsschicht und vielen Medien gleichermaßen ›angenommen‹ – es bleibt eine Frage der gesamtgesellschaftlichen Ausverhandlung, ob und wie stark bestimmte historische Ereignisse auf Interesse stoßen.« Und was den Ersten Weltkrieg betrifft: Noch bis 2018 wird man sich künstlich und künstlerisch exakt hundert Jahre später an den Krieg und hoffentlich auch an seine Gräuel erinnern; dieser Krieg ist der Hundertjährige, der durchs Fenster hereinkletterte und nicht aufhörte, Faxen zu machen. Gequält wird man sich über die Grenze zwischen Erinnern, Gedenken und Zelebrieren manövrieren. Zwischendurch darf man getrost den einen oder anderen Fernsehbericht auslassen und in Elena Messners fiktives Heute eintauchen, das nicht weniger real ist, aber besser geschrieben.