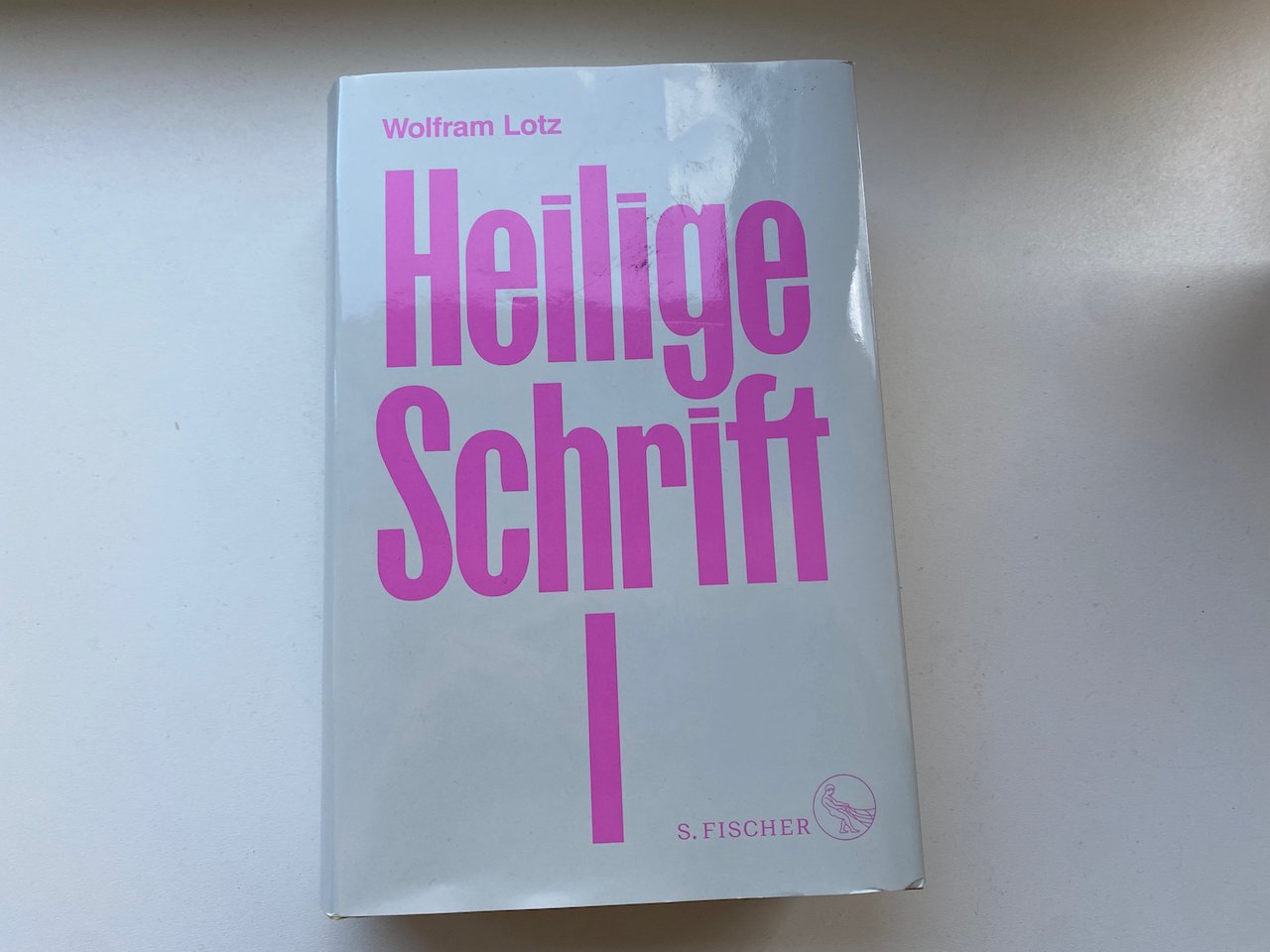Über ein Jahr lang mit dem Stift in der Hand jeden Gedanken, jede Idee und jede Regung des Geistes zu notieren, schreibend die Dinge zu berühren und somit die Welt aufmerksamer zu sehen, diesen Plan fasste Theaterautor Wolfram Lotz, nachdem er erfahren hatte, dass er ein Jahr in der »Weltabgewandtheitshöhle« verbringen würde: Ein kleines französisches Dorf, in dem seine Partnerin als Lehrerin unterrichtete.
Einzige Bedingung an sich selbst: Der entstehende Text dürfe nie an die Öffentlichkeit gelangen … Warum dieses eigenwillig-faszinierende Tagebuch, obwohl Lotz es am Ende gelöscht hatte, nun doch in Form von über 900 Seiten uns Leser/innen vorliegt und warum Lotz immer noch ein klein wenig damit hadert, erzählt er Buchkultur-Redakteur Martin Thomas Pesl im Interview. Foto: Jürgen Beck.
Wann und warum haben Sie Ihr über ein Jahr in Frankreich geführtes Tagebuch vernichtet?
Naja, ich habe es gelöscht. Vernichtet ist ein rabiates Wort. Es war ja kein irrationaler Vorgang, sondern eine kühle, rationale Entscheidung. In der Herangehensweise an die Welt sollte es eigentlich ein leichtes Schreiben sein. Eine Art, die Dinge in einer Beiläufigkeit zu berühren und nicht mit einem gewaltsamen Zugang, aber es hat natürlich dennoch etwas Monströses, ein Jahr jeden Tag von morgens bis nachts zu schreiben, zu beobachten – ich hätte das aber irgendwie nicht anders gekonnt. Dieses Monströse musste für mich wahrscheinlich im Nachhinein gebannt werden. Die Entscheidung ist für mich kurz nach dem Schreiben gefallen. Im Frühjahr hatte ich zwei Freunden den Anfang geschickt, das waren nur die ersten 800 Seiten, und der eine, er ist Regisseur, erzählte es in der Kantine weiter. Da rief das Theater bei meiner Theaterlektorin zwei Monate vor Ende an und erzählte ihr, dass ich da was schreibe. Sie wollte das auch lesen, also habe ich ihr genau diese Datei dann halt auch geschickt, eher persönlich, weil wir befreundet sind. Aber natürlich kam es dadurch dann doch näher an eine weitere Veräußerung heran, und das habe ich auch sofort im Schreiben gemerkt. Wichtig war für mich beim Schreiben aber, dass ich es nur für mich mache, als Praxis. Es ging mir nicht um das Erstellen eines Textes, sondern darum, in dem Moment schreibend die Dinge zu berühren, für niemand anderen.
Wobei aus dem ersten Teil hervorgeht, dass Sie ständig mit dem Gedanken gespielt haben, dass es vielleicht doch für die Öffentlichkeit ist.
Tja, das sind die Widersprüche, die man nicht loswird. Am Anfang ist es vor allem ein Runterkommen vom Veröffentlichungsgedanken, also die Idee, es eventuell ins Internet zu stellen, auf den Server meines Bruders, wo es auch technischen Gründen nicht aufzufinden gewesen wäre, ungoogelbar, ich hätte es genauso gut hinter den Schrank stecken können. Bisschen paradox, aber der Gedanke war: es zwar zu veröffentlichen, aber an einer Stelle, wo es niemand lesen kann. Ich hatte mich ja entschieden, ein Jahr lang von morgens bis abends Dinge aufzuschreiben – das muss man vor sich selbst auch erstmal rechtfertigen. Es ist durchaus widersprüchlich, und irgendwie habe ich mich selbst leicht beschwindeln müssen, um mich dann freimachen zu können. Im Schreiben geht es vielleicht immer darum, ein Selbstgespräch zu führen, das aber für die anderen hörbar sein könnte – selbst vor dem Spiegel ist man ja nicht alleine. Sobald man etwas denkend formuliert, geht damit auch immer die Möglichkeit einher, die Gedanken zu teilen – auch wenn man es nicht vorhat. Am Ende wollte ich den Text aber einer Veröffentlichung entziehen, weil ich ihn als Lebenspraxis nicht verraten wollte. Natürlich hätte ich ihn dafür nicht löschen müssen. Aber es ging mir darum, mich der Versuchung zu entziehen. Dem Verlag, ohne lügen zu müssen, zu sagen: Tut mir leid, das gibt‘s nicht mehr.