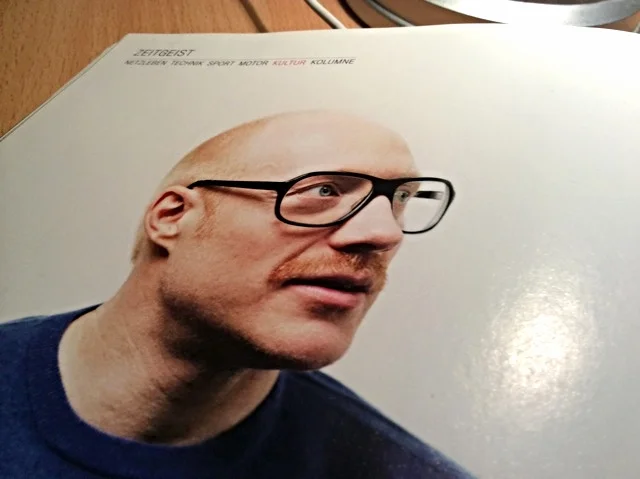Worin besteht denn Ihr Idealismus? Ich bin generell sehr skeptisch, was Idealismus anbelangt. Ich halte das für eine vorgeschobene Lebenshaltung, die nicht der Realität entspricht. Wir Menschen sind genetisch mit dem Selbsterhaltungstrieb ausgestattet. Bereits die Nation ist eine Fehlkonstruktion. Idealismus ist vielfach nur vorgetäuscht. Nichts dagegen, wenn jemand mehr für andere tut als für sich selber. Aber ich würde mich freuen, wenn er das aus Egoismus tut, weil es ihm guttut. Wenn es mir guttut, eine Stiftung für Bergvölker zu gründen, tue ich das. Aber ich laufe nicht herum und sage, ich bin ein Idealist.
Sie sagen, dass bestiegene Berge für Sie banal werden. Wann setzt die Banalisierung ein? Ich muss auf jeden Fall noch zurückkommen: Das Absteigen ist anstrengend und immer noch mit Gefahren behaftet. Was sich ein Laie unter der Gipfelklimax vorstellt, das findet nachher statt, und das ist so ein Wiedergeborensein-Gefühl. Damit beginnt bereits auch die Banalisierung. In meinem Erinnern ist der Berg dann nicht mehr das, was er vorher war.
Was können Sie sich noch vorstellen zu machen, wo alle sagen, das schafft er nie? In dieser Sparte habe ich keine Chance mehr. Wenn ich mir einbilden würde, ich könne noch so gut klettern, wie heute die besten Kletterer der Welt, dann würden alle sagen: Du bist krank. Ich konnte zwischen 22 und 25 wirklich gut klettern. Nachher war ich nicht mehr in der Lage, weil meine Füße erfroren waren. Da habe ich etwas völlig Neues gemacht: das Höhenbergsteigen. Zwischen 25 und 40 habe ich alle Achttausender bestiegen und viele Pioniertaten versucht, und einige sind mir auch gelungen. Alles Dinge, wo man gesagt hat: Unmöglich, entweder kommt er um, oder es gelingt nicht. Und dann war die Banalisierung perfekt. Es war keine Aufregung mehr, die Seesäcke zu packen und zum nächsten Achttausender zu fahren. Da entschied ich: Jetzt lasse ich das, ich kann nicht mehr höher, ich kann nicht mehr alleiner. Also habe ich in der Horizontale alle möglichen Problemstellungen gefunden, die Gobi und die Antarktis durchquert. Das war im Grunde so schwierig nicht, aber nach 1912, nach dem Tod von Scott hatten die Leute diese Spielmöglichkeit einfach vergessen. Als ich dann wieder verunglückte und mir das Fersenbein zertrümmerte, erkannte ich: Es ist besser, du machst jetzt was Vernünftiges, sonst kommst du um.
Womit verbringen Sie jetzt hauptsächlich Ihre Zeit? In den letzten zehn Jahren mit meinem Museum. Das hat mir gleich viele Emotionen und auch Herausforderungen verschafft wie eine Expedition zum Everest. Sich das auszudenken, die richtigen Leute zu finden, die Finanzierung auf die Beine zu stellen...
Was schreiben Sie in einem Formular unter „Beruf“? Heute schreibe ich Bergbauer. Ich bin im Moment mehr Bergbauer als Bergsteiger. Ich mache genaue Beobachtungen, wie die Bergbauern seit Tausenden von Jahren in den Alpen überleben, aber auch im Himalaya und in den Anden.
Wie finden Sie Andreas Nickels Film? Ihm ist es gelungen, ein recht gutes Psychogramm zu liefern, indem er die richtigen Leute befragt hat. Alles kommt erzählerisch daher und wirkt daher nicht schwer. Einiges ist sehr emotional für mich: Die Bilder vom Nanga Parbat sind echt. Die waren verschollen, ich wusste nicht, dass es sie gibt. Auch wie das gedreht wurde, weiß ich nicht. Es war höllisch kalt und ein fürchterlicher Sturm. Da sieht man wirklich, was es heißt, in dieser Höhe überhaupt am Leben zu bleiben. Wenn ich aber nur die Riegler-Brüder sehe, die den Messner Günther und den Messner Reinhold spielen, das ist für mich keine Aufregung.
Apropos Messner Günther: Wenn Ihr Bruder 1970 am Nanga Parbat überlebt hätte, wären Sie dann weniger zum Einzelgänger geworden? Das kam nicht mit dieser Expedition, sondern mit der nächsten, wo wieder ein Unfall passiert ist. Da sagte ich: Ich glaube, ich kann das auch allein. Ich brauchte dann relativ lange, bis ich es auch allein konnte. Insgesamt bin ich aber mehr ein Gemeinschaftsplayer in ganz kleinen Gruppen. Ich habe nur in jeder Sparte auch versucht zu schauen: Kann ich das allein?
Alle Ihre Brüder sind Professoren und Doktoren. Sie sind dafür weltberühmt. Gibt es da einen wechselseitigen Neid? Es gab vielleicht ein Gefühl der Ungerechtigkeit: Der Freak, der kein Akademiker wurde, ist mit seinen Spinnereien relativ erfolgreich geworden. Aber mit zunehmendem Erfolg der einzelnen Brüder gibt es ein gutes Großfamiliendasein. Die Mutter hat auf dem Totenbett gesagt: Ich wünsche mir, dass ihr euch mindestens ein Mal im Jahr alle – da darf keiner fehlen – trefft. Erst kürzlich beim runden Geburtstag meiner Frau.
Wie müsste ich eine Frage zum Yeti formulieren, sodass Sie Ihnen nicht auf die Nerven geht? Indem Sie gleich zeigen, dass Sie die Grundvoraussetzungen verstanden haben: Der Yeti ist eindeutig eine Legendenfigur, die nur in der Fantasie von Menschen vorkommt. Vor 130 Jahren hat ein Journalist diese Figur nach Europa gebracht, die Geschichte nicht verstanden, den Namen erfunden. So entstand diese Vorstellung eines Neandertalers zwischen Affe und Mensch. In Wirklichkeit ist eindeutig nachgewiesen, dass die Legende vom Yeti eine zoologische Entsprechung hat, den Schneebär oder Tibetbär. Da gibt es keinen Zweifel.
Wie konnte es passieren, dass damals die Idee entstanden ist, Sie hätten ein Fabelwesen gesehen? Weil die Leute alle an einen realen Affenmenschen gedacht haben. Sie haben erwartet, dass ich ihre verfälschte Vorstellung vom Yeti auf die Bühne hebe. Obwohl ich gesagt habe: Nein, nein, ihr habt alle ein falsches Bild im Kopf, wollten sie „ihren“ Yeti bewiesen haben. Die Menschen glauben lieber an das Undenkbare, an das völlig Irre, als an die Realität. Dazu passt die Frechheit, in der christlichen Kirche Gott darzustellen, oben am großen Gewölbe! Die Muslime sind wenigstens so intelligent und haben verboten, Allah abzubilden. Wir haben gar kein Instrument, das Göttliche zu erkennen, damit zu malen, zu denken. Sonst wären wir selber göttlich.